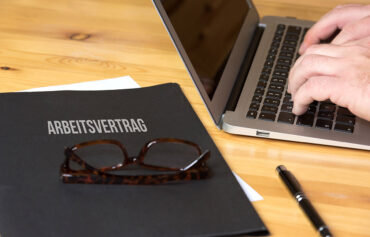- Arbeitsmarkt, Politik, Wirtschaft - Pierre-Gabriel Bieri
Finanzierung GAV: nichts zu verbergen

Finanzierung GAV: nichts zu verbergen. Zwei Vorschläge im Zusammenhang mit der Funktionsweise von Gesamtarbeitsverträgen (GAV) befinden sich derzeit in parlamentarischer Beratung. Der erste, ungeschickte Vorschlag versucht, die Konflikte zwischen den branchenspezifischen und gesetzlichen Mindestlöhnen, die in einigen Kantonen existieren, zu lösen. Der zweite Vorschlag, der unterstützenswert ist und sogar erweitert werden könnte, zielt darauf ab, die finanzielle Transparenz von Gesamtarbeitsverträgen und damit das Vertrauen in die Sozialpartnerschaft zu stärken.
Eine falsche Antwort auf ein institutionelles und rechtliches Durcheinander
Das Bundesgesetz über die Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen (AVEG) ist derzeit Gegenstand von zwei Änderungsvorschlägen in Form von zwei aufeinanderfolgenden Vorlagen, die der Bundesrat im vergangenen Dezember an das Parlament überwiesen hat. Die Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats wird diese beiden Vorlagen, welche Anfang 2024 ein gemeinsames Vernehmlassungsverfahren durchlaufen haben, beraten.
Die erste Vorlage (24.096) versucht, einen Konflikt von Rechtsnormen zu lösen. Ein solcher ergibt sich seit einigen Jahren, wenn ein festgelegter Mindestlohn, der auf einem schweizweit gültigen und für allgemeinverbindlich erklärten GAV beruht, mit einem kantonal beschlossenen gesetzlichen Mindestlohn kollidiert. Nach geltendem Recht haben die Bestimmungen eines privaten Vertrags, dem durch eine Verwaltungsentscheidung Gesetzeskraft verliehen wurde, keinen Vorrang vor einem Gesetz, das von einem Parlament verabschiedet und durch eine Volksabstimmung bestätigt worden ist. Dennoch hat das eidgenössische Parlament einer Motion zugestimmt, die eine Umkehrung dieser Rangordnung verlangt. Dies mit dem lobenswerten Ziel, die Sozialpartnerschaft zu stärken… aber unter Missachtung der institutionellen Ordnung. Der Bundesrat, der dieses Ansinnen ablehnte, musste dem Antrag des Parlaments Folge leisten und schlug vor, das AVEG dahingehend zu ergänzen, als dass Bestimmungen über Mindestlöhne (in GAV), die zwingenden Bestimmungen des kantonalen Rechts widersprechen, durchaus als allgemeinverbindlich erklärt werden können.
Diese etwas umständliche Formulierung stellt eine unzulängliche Antwort auf das Problem dar. Um einen Normenkonflikt zu vermeiden, sind die Kantone gefordert: Indem sie die Sozialpartnerschaft respektieren und in ihrer Gesetzgebung auf die Festlegung eines Mindestlohns verzichten oder zumindest den subsidiären Charakter des gesetzlichen Mindestlohns ausdrücklich festhalten, so dass dieser nur in Branchen ohne gültigen GAV angewendet werden würde. Grundsätzlich ist es nicht wünschenswert, dass das AVEG in diesem Punkt angepasst wird.
GAV dienen nicht der Bereicherung der Sozialpartner
Die zweite Vorlage (24.097) ist interessanter und viel unterstützenswerter. Sie verlangt, dass allen einem allgemeinverbindlichen GAV unterliegenden Arbeitgebern und Arbeitnehmern bei Zahlung von Vollzugskostenbeiträgen für diesen GAV ein kostenloses Einsichtsrecht in die Jahresrechnung der zuständigen paritätischen Kommission gewährt wird.
Politiker, die grundsätzlich gegen GAV sind, werfen dem Instrument regelmässig vor, die Gewerkschafts- und Arbeitgeberorganisationen zu bereichern, die solche unterzeichnet haben. Diese Verdächtigungen sind falsch und auch nicht fundiert, da die Konten der paritätischen Kommissionen, die GAV verwalten, kontrolliert werden und die Verwendung ihrer Mittel durch die Richtlinien des Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO) eng begrenzt ist. Im Jahr 2023 wurde die Finanzaufsicht des SECO in diesem Bereich von der Eidgenössischen Finanzkontrolle ohne materiellen Befund überprüft. Der Prüfungsbericht beinhaltete nur zwei Empfehlungen, die umgesetzt werden.
Die Umsetzung eines GAV mit Kontrollen, Aufforderungen zur Einhaltung der Vorschriften und möglichen Sanktionen erfordert Zeit und Personal. Die paritätischen Fonds dienen der Finanzierung dieses Betriebs sowie weiterer spezifischer Massnahmen in den Bereichen Weiterbildung, Sicherheit und Gesundheit. Wenn die eingenommenen Beiträge die Ausgaben übersteigen, müssen die Sozialpartner Mittel und Wege finden, die Reserven abzubauen, dürfen diese aber unter keinen Umständen zur eigenen Finanzierung nutzen.
Es ist dabei zu präzisieren, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber, die Mitglied einer unterzeichnenden Organisation sind, einen Teil ihrer Beiträge zurückerstattet bekommen oder davon befreit werden können. So kann vermieden werden, dass sie für dieselben Leistungen doppelt bezahlen – einmal durch ihren Mitgliederbeitrag und ein zweites Mal in Form des Vollzugskostenbeitrages. Das aktuelle System ist legitim und verhindert, dass die Sozialpartnerschaft eine übermässige finanzielle Belastung für diejenigen darstellt, die sie am Leben erhalten.
„Die Konten der paritätischen Kommissionen werden kontrolliert und die Verwendung ihrer Mittel ist durch die Richtlinien des SECO eng begrenzt.“
Transparenz, die sich auszahlt
Centre Patronal verwaltet zahlreiche Arbeitgeberverbände und mehr als ein Dutzend paritätische Kommissionen. Wir unterstützten die Bemühungen vollumfänglich, mehr Transparenz in die Finanzströme, die sich aus der Sozialpartnerschaft ergeben, zu bringen. Vor einem Jahr haben wir verschiedene Vorschläge veröffentlicht, die darauf abzielen, die Bedingungen für die Allgemeinverbindlichkeit eines GAV zu modernisieren und das allgemeine Vertrauen in deren Funktionsweise zu stärken.
Dabei ging es nicht nur darum, den Arbeitgebern und Arbeitnehmern, die einem allgemeinverbindlichen GAV unterstehen, das Recht auf Einsicht in die Jahresrechnungen der paritätischen Kommissionen zu gewähren, wie es die oben erwähnte Gesetzesänderung vorschlägt. Vielmehr sollen auch mehrere Grundsätze gesetzlich verankert werden (im AVEG), die derzeit nur in Richtlinien des SECO enthalten sind (Kontrolle der Konten und Ausgaben der paritätischen Kommissionen, Verbot der Bereicherung der Sozialpartner durch entsprechende Überschüsse usw.). Diese Grundsätze werden bereits heute korrekt angewendet, aber eine Verankerung in der Gesetzgebung würde ihnen mehr Gewicht und Bekanntheit verleihen.
Die bewährte Sozialpartnerschaft in der Schweiz schützt die Arbeitsbedingungen von mehr als 2,1 Millionen Arbeitnehmenden. Gleichzeitig ist sie ein Bollwerk gegen den Etatismus und ein Stabilitätsfaktor. Eine volle Transparenz bezüglich der Finanzströme kann nur von Vorteil sein.
Weiterführende Informationen zum Beitrag “Finanzierung GAV: nichts zu verbergen“:
Bundesamt für Statistik BFS:
- Gesamtarbeitsverträge und Sozialpartnerschaft
- Gesamtarbeitsverträge (GAV) und Normalarbeitsverträge (NAV) in der Schweiz nach Wirtschaftssektor