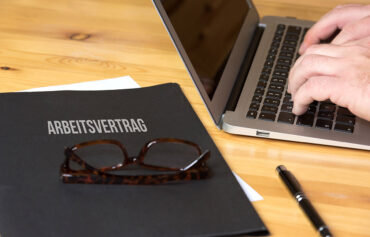- Arbeitsmarkt, Politik, Wirtschaft - Pierre-Gabriel Bieri
Bilaterale III: Analyse versus Panikmache

Bilaterale III: Analyse versus Panikmache. Die Gewerkschaften halten die Zugeständnisse, die die Schweiz im Zusammenhang mit entsandten Arbeitnehmern gemacht hat – Spesenregelung, Voranmeldefrist und Kautionsregelung – für inakzeptabel. Wenn man diese Anpassungen jedoch objektiv analysiert, kann man nicht behaupten, dass sie eine echte Bedrohung für das Schweizer Lohnniveau darstellen.
Lohnschutz geopfert?
In einer Zeit, in der die Verschärfung der weltweiten Handelsbeziehungen die Medien beherrscht, dürfen wir die anderen wichtigen Dossiers unserer Aussenpolitik nicht aus den Augen verlieren, allen voran die bilateralen Beziehungen zwischen der Schweiz und der Europäischen Union (EU).
Seit etwa zehn Jahren ist bekannt, dass diese Beziehungen modernisiert und auf neue Bereiche ausgeweitet werden müssen. Nach einem ersten Scheitern im Jahr 2021 wurden im Frühjahr 2024 neue Verhandlungen aufgenommen. Sie wurden vor Heiligabend materiell abgeschlossen, wobei der formelle Abschluss in diesem Frühjahr erfolgen soll. Bisher wurde noch kein Text veröffentlicht, und man kann sich heute nur auf die vom Bund veröffentlichten „Informationsblätter“ stützen. Dennoch geben die bislang bekannten Inhalte bereits Anlass zu vielfältiger Kritik, einerseits zu institutionellen Fragen, andererseits zum Schutz der Löhne und Arbeitsbedingungen.
Die Befürchtungen institutioneller Art betreffen die Übernahme künftiger Entwicklungen des EU-Rechts durch die Schweiz. Es ist bekannt, dass mögliche Streitigkeiten vor einem Schiedsgericht, das sich aus schweizerischen und europäischen Richtern zusammensetzt, ausgetragen werden müssen. Dieser Mechanismus wird im Lichte der zu veröffentlichenden Texte zu bewerten sein.
Es lohnt sich, einen Blick auf die anderen Kritikpunkte zu werfen, die von den Gewerkschaften geäussert werden, die in einem „verschlechterten Lohnschutz“ eine Bedrohung sehen – wie Pierre-Yves Maillard, Präsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes, es zum Ausdruck brachte. Die Kontroverse betrifft die Regeln für die Beschäftigung ausländischer Arbeitnehmer, die für zeitlich begrenzte Arbeiten in die Schweiz entsandt werden. Die Schweiz hat von Anfang an und zu Recht erklärt, dass die Aufrechterhaltung der flankierenden Massnahmen zum Schutz des Schweizer Lohnniveaus eine rote Linie darstellt.
Eine Richtlinie, die sechzehn europäische Staaten nicht umsetzen
Es ist bekannt, dass die Schweiz in diesem Bereich einige Zugeständnisse gemacht hat. Handelt es sich also um einfache Anpassungen oder um einen unannehmbaren Abbau? Der erste Punkt, der von den Gewerkschaften heftig kritisiert wurde, betrifft die Spesenentschädigung. Entsandte Arbeitnehmer erhalten weiterhin einen Lohn, der den Normen des Arbeitsortes entspricht, aber ihre Reise-, Unterkunfts- und Verpflegungskosten sollen nicht mehr nach Schweizer Recht, sondern nach den Regeln ihres Herkunftslandes erstattet werden, wie es eine EU-Richtlinie aus dem Jahr 2018 vorschreibt.
Diese Lösung ist zweifellos unbefriedigend. In einem ersten Schritt sollten jedoch ihre tatsächlichen Auswirkungen bewertet werden. Laut SECO kommen jedes Jahr etwa 80’000 bis 90’000 entsandte Arbeitnehmer in die Schweiz. 80% von ihnen stammen jedoch aus Nachbarländern, die eine mit der Schweiz vergleichbare Regelung kennen. Die Zahl der ausländischen Arbeitnehmer, die potenziell zu niedrigeren Bedingungen entlohnt werden, würde sich somit auf etwa 17’000 beschränken – das entspricht 0,3% der 5,2 Millionen Arbeitnehmer in der Schweiz. Darüber hinaus dauern drei Viertel der Einsätze in der Schweiz weniger als fünf Tage und ein Drittel nicht länger als einen Tag. Die Kosten für solch kurze Dienstreisen halten sich in Grenzen.
Zweitens ist auch und vor allem zu berücksichtigen, dass 16 EU-Mitgliedstaaten die entsprechende EU-Richtlinie – laut Aussage der SECO-Direktorin – schlichtweg nicht umsetzen. Vor diesem Hintergrund kann und sollte die Schweiz von dieser unklaren Rechtslage profitieren und an einer autonomen Regelung der Spesenerstattung festhalten.
„Die Kritik der Gewerkschaften erscheint eher als übertriebene Panikmache denn als objektive Analyse.“
Verfahren, die modernisiert werden müssen
Das zweite Zugeständnis, das die Gewerkschaften verärgert, ist die Verkürzung der Voranmeldefrist. Heute muss die Ankunft entsandter Arbeitnehmer mindestens acht Kalendertage vor Beginn der Arbeiten in der Schweiz angekündigt werden, damit die zuständigen Organe Kontrollen organisieren können. Die EU akzeptiert grundsätzlich eine Frist, verlangt aber, dass sie auf vier Arbeitstage verkürzt wird. In diesem Zusammenhang hat der Bund kürzlich die Ergebnisse eines Pilotprojekts in der Region Basel veröffentlicht. Die kantonalen Vollzugsorgane beurteilten, dass mit einer Frist von vier Tagen die Kontrollen in 90% der Fälle durchführbar waren. In den übrigen Fällen scheinen die Schwierigkeiten vor allem auf mangelnde Effizienz zurückzuführen zu sein, da die Meldungen nicht automatisch und elektronisch weitergeleitet werden. Eine Modernisierung des Systems würde es sicherlich ermöglichen, das Anmeldeverfahren auch unter den von der EU gestellten Bedingungen effizient zu gestalten.
Der dritte und letzte strittige Punkt betrifft die Hinterlegung einer Kaution durch ausländische Unternehmen, die Arbeitnehmer in die Schweiz entsenden. Diese Kaution darf künftig nicht mehr von allen Unternehmen verlangt werden, sondern nur noch von jenen, die bereits früher wegen der Nichteinhaltung der schweizerischen Gesetzgebung am Pranger standen.
Selbst wenn man sehr sensibel für die Notwendigkeit ist, die in der Schweiz herrschenden Arbeitsbedingungen zu schützen, kann man schwerlich zu dem Schluss kommen, dass diese Änderungen eine grosse Bedrohung für das Lohnniveau darstellen. Es gibt übrigens auch sozialdemokratische Politiker, die diese Einschätzung teilen und behaupten, dass die Fragen im Zusammenhang mit der Spesenregelung keine Rechtfertigung für eine Blockade der „Bilateralen III“ darstellen. In diesem Sinne erscheint die gewerkschaftliche Kritik eher als übertriebene Panikmache denn als objektive Analyse.
Weiterführende Informationen zum Beitrag “Bilaterale III: Analyse versus Panikmache“:
Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA
Faktenblätter:
- Institutionelle Elemente (PDF, 282 kB)
- Schweizer Beitrag (PDF, 279 kB)
- Staatliche Beihilfen (PDF, 394 kB)
- Zuwanderung (PDF, 161 kB)
- Lohnschutz (PDF, 275 kB)
- MRA (PDF, 328 kB)
- Luftverkehr (PDF, 278 kB)
- Strom (PDF, 266 kB)
- Gesundheit (PDF, 225 kB)
- EU-Programme (PDF, 215 kB)
- Landverkehr (PDF, 215 kB)
- Landwirtschaftsabkommen und Lebensmittelsicherheit (PDF, 201 kB)