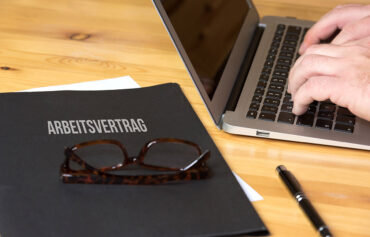- Arbeitsmarkt, Politik, Wirtschaft - Pierre-Gabriel Bieri
Lohngleichheit: Gesetz umsetzen statt verschärfen

Lohngleichheit: Gesetz umsetzen statt verschärfen. Ein auf einer freiwilligen Umfrage basierender Bericht des Bundesamtes für Justiz zeigt, dass mehr als die Hälfte der befragten Arbeitgeber ihre Pflicht zur Durchführung einer Lohngleichheitsanalyse nicht vollständig erfüllt. Das ist nicht entschuldbar, rechtfertigt aber noch lange nicht die Schaffung einer Fülle von neuen Kontroll- und Strafmassnahmen. Dabei gilt es nicht aus den Augen zu verlieren, dass die Lohngleichheit in die richtige Richtung geht.
Neue gesetzliche Auflagen seit 2020
Am Freitag, 7. März, legte der Bundesrat eine Zwischenbilanz zur Lohngleichheit vor, basierend auf einem etwa fünfzehnseitigen Bericht, wonach „die Analyse zur Lohngleichheit nur ungenügend durchgeführt wird“. Die Gewerkschaften reagierten reflexartig mit Empörung und Theatralik und behaupteten, dass das Gleichstellungsgesetz angesichts der „sehr hohen“ Lohnunterschiede (mit schwindelerregenden Zahlen untermauert), die „Armut“ und „wirtschaftliche Abhängigkeit“ erzeugten, gescheitert sei. Die Lösung: „eine Pflicht zur regelmässigen Lohnanalyse aller Unternehmen – unabhängig ihrer Grösse“ (!) sowie staatliche Kontrollen und strenge Sanktionen. Postwendend lehnte der Schweizerische Gewerbeverband jedwede Verschärfung der Verpflichtungen der Arbeitgeber ab.
Um zu verstehen, worum es geht, muss man den vorgestellten Bericht lesen.
Das Bundesgesetz über die Gleichstellung von Frau und Mann (GlG) enthält seit dem 1. Juli 2020 – und befristet bis zum 30. Juni 2032 – einen neuen Abschnitt 4a mit dem Titel „Lohngleichheitsanalyse und Überprüfung“. Die darin enthaltenen Bestimmungen verpflichten alle Unternehmen mit mindestens 100 Beschäftigten, eine interne Analyse der Lohngleichheit durchzuführen, diese Analyse anschliessend von einer unabhängigen Stelle überprüfen zu lassen und schliesslich alle Mitarbeiter über die Ergebnisse der Analyse zu informieren. Dafür gab es Fristen: Die erste Analyse musste bis spätestens am 30. Juni 2021 durchgeführt sein, die Überprüfung dieser Analyse bis spätestens am 30. Juni 2022 und die Information der Beschäftigten bis am 30. Juni 2023. Der gesamte Prozess ist alle vier Jahre zu wiederholen, es sei denn, das Resultat der Analyse ist Lohngleichheit.
Die Auswirkungen dieser obligatorischen Analysen werden Gegenstand eines späteren Berichts sein, der ursprünglich für 2029 vorgesehen war, jetzt aber auf 2027 vorgezogen werden könnte. Der Bericht von letzter Woche ist eine Zwischenbilanz, die den Fokus auf die Umsetzung dieser neuen Verpflichtungen richtet bzw. darauf, wie die Unternehmen diese Pflichten umsetzten. Der Bericht macht keine Aussage über die Wirksamkeit des Gleichstellungsgesetzes – das Gegenteil von dem, was uns die gewerkschaftliche Agitation glauben machen will.
Lehren aus dem Bericht des Bundesrats
Die Ergebnisse des Berichts basieren auf einer „freiwilligen Umfrage“ unter Arbeitgebern, die der neuen Pflicht zur Lohnanalyse unterliegen. Fast 40% von ihnen haben geantwortet. Das gilt als hoher Anteil. Die Umfrage zeigt zusammenfassend, dass 81% der antwortenden Arbeitgeber die Verpflichtung zur Durchführung einer Analyse der Lohngleichheit einhielten, aber nur 68% diese Analyse einer externen Überprüfung unterzogen, während 49% ihrer Pflicht zur Information der Belegschaft nachkamen.
Bei drei Vierteln der antwortenden Arbeitgeber haben die Analyseergebnisse keinen Geschlechtereffekt zu Tage gebracht. Rund ein Fünftel wies einen Geschlechtereffekt aus, der eine allfällige Toleranzschwelle nicht überschritt. 1,2% der antwortenden Arbeitgeber gaben an, dass eine Toleranzschwelle überschritten wurde.
Es zeigt sich auch, dass die meisten Arbeitgeber, die eine Analyse durchgeführt haben, dafür zwischen einem und drei Arbeitstagen benötigten. Die grössten Schwierigkeiten bestanden in fehlenden oder nicht direkt verfügbaren Daten.
„Die Polemik über die Erfüllung der im GlG vorgesehenen bürokratischen Vorschriften lässt keine Rückschlüsse auf die Lohnungleichheiten selbst zu.“
Lohnschere schliesst sich
Die wichtigste Schlussfolgerung ist, dass eine Mehrheit der befragten Arbeitgeber die im GlG festgelegten neuen Vorschriften nicht gebührend ernst nimmt. Die Mehrheit hat die Lohngleichheitsanalysen durchgeführt, aber die Überprüfungs- und Informationspflichten vernachlässigt; manchmal mit der Begründung, dass sie das Gesetz nicht kennen, manchmal auch im Brustton der Überzeugung, dass diese Pflichten unnötig seien. Das ist weder klug noch gibt es eine Entschuldigung für ein solches Verhalten. Selbstverständlich steht es einem frei, bestimmte gesetzliche Normen als unangemessen oder unerwünscht anzusehen. Die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen ist aber nun Mal kein Wunschkonzert – schon allein, um den bürokratischen Eifer des Gesetzgebers nicht zu provozieren.
Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass gemäss Bericht ausgerechnet der öffentliche Sektor mit Disziplinlosigkeit glänzt und „seine Vorbildfunktion nicht erfüllt“. So hat die Hälfte der öffentlichen Arbeitgeber die Ergebnisse ihrer Analysen nicht veröffentlicht, und diejenigen, die dies getan haben, „haben dies im Allgemeinen eher oberflächlich getan“.
Wichtig ist zu betonen, dass die Polemik über die im Gleichstellungsgesetz vorgesehenen bürokratischen Vorschriften keine Rückschlüsse auf die Lohnungleichheit selbst zulässt. Die neuesten Zahlen stammen vom Bundesamt für Statistik und wurden im November 2024 veröffentlicht: Insgesamt ist das durchschnittliche Lohngefälle zwischen Männern und Frauen in der Schweizer Wirtschaft weiter zurückgegangen, von 18% im Jahr 2020 auf 16,2% im Jahr 2022. Ein erheblicher Teil dieser Differenz lässt sich auf objektive, sprich erklärte Unterschiede, belegen, insbesondere in Bezug auf die berufliche Stellung oder die Ausbildung. Der unerklärte Teil der Lohnunterschiede (unerklärt bedeutet nicht unbedingt diskriminierend, es kann sich um nicht erfasste objektive Unterschiede handeln) belief sich 2022 auf etwa 7,8% (gegenüber 8,6% im Jahr 2020).
Basierend auf diesen Zahlen gilt es, die Situation zu analysieren. Ein vorschnelles Handeln mit einem Arsenal an zusätzlichen repressiven Massnahmen rechtfertigen sie ganz gewiss nicht.
Weiterführende Informationen zum Beitrag “Lohngleichheit: Gesetz umsetzen statt verschärfen“:
Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann EBG: Bundesgesetz über die Gleichstellung von Frau und Mann (Gleichstellungsgesetz, GIG)