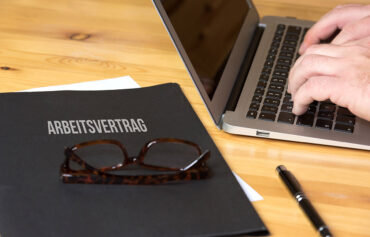- Arbeitsmarkt, Parlament, Politik, Wirtschaft - Pierre-Gabriel Bieri
Lockerung der Vorschriften für Telearbeit

Lockerung der Vorschriften für Telearbeit. Seit fast neun Jahren liegt dem Parlament ein Antrag zur Verbesserung und Modernisierung der Vorschriften zur Telearbeit vor. Das Arbeitsgesetz, das nicht mehr dem heutigen Kontext entspricht, erfordert eine umfassendere Reform, insbesondere in Bezug auf die Regelungen zu Arbeits- und Ruhezeiten. Zudem muss die Anwendung des Gesetzes auf Führungskräfte, die in ihrer Arbeitsweise weitgehend autonom sind, kritisch hinterfragt werden.
Ein Antrag, der vor fast neun Jahren gestellt wurde
Im vergangenen Herbst hat die Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats (WAK-N) Vorschläge zur Verbesserung und Modernisierung der Bestimmungen zur Telearbeit in die Vernehmlassung gegeben. Diese beruhen auf einer parlamentarischen Initiative von Nationalrat Thierry Burkart aus dem Jahr 2016 – also lange vor den neuen Telearbeitsgewohnheiten, die sich während der Covid-Krise etabliert haben. Die lange Verzögerung bei der Behandlung dieses Themas lässt sich jedoch nicht allein mit der Pandemie erklären. Vielmehr könnte es daran liegen, dass sich die Parlamentarier der Tatsache bewusst geworden sind, dass die Lockerung der Telearbeitsvorschriften nur ein Teilaspekt eines weit umfassenderen und grundlegenderen Problems ist: der zunehmenden Unzulänglichkeit des Arbeitsgesetzes (ArG) im Hinblick auf die heutigen Realitäten der Arbeitswelt.
Es ist selbstverständlich zu begrüssen, dass dieses Dossier nun vorangetrieben wird – auch wenn es sich nur um einen beschränkten Aspekt handelt. Nach Abschluss der Vernehmlassung kurz vor Weihnachten bereitet sich die WAK-N nun darauf vor, ihre Arbeit an der Vorlage (16.484) wieder aufzunehmen.
Der von der Kommission ausgearbeitete Entwurf sieht zwei Varianten vor. Die erste besteht darin, den Begriff des „Telearbeitsvertrags“ im Obligationenrecht zu verankern. Da das Obligationenrecht bereits die Möglichkeit bietet, Betriebsreglemente zur Telearbeit zu erlassen, erscheint diese Variante wenig zielführend. Die zweite, weitaus interessantere Variante, die zudem der ursprünglichen parlamentarischen Initiative besser entspricht, sieht eine gezielte Anpassung des Arbeitsgesetzes vor. Konkret soll das Gesetz um ein neues Kapitel „Arbeits- und Ruhezeiten bei Telearbeit“ erweitert werden. Dieses würde für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gelten, die in der Gestaltung ihrer Arbeit und Arbeitszeiten weitgehend autonom sind, sofern sie mit ihrem Arbeitgeber schriftlich vereinbart haben, dass sie ihre Tätigkeit ganz oder teilweise ausserhalb des Betriebs erbringen können.
Erkennen von Praktiken, die üblich geworden sind
Die in diesem neuen Kapitel vorgeschlagenen Bestimmungen gehen insgesamt in die richtige Richtung – auch wenn sie nicht ideal sind und die ohnehin schon komplexen Regelungen weiter verkomplizieren. Die Zeitspanne zwischen Tages- und Abendarbeit soll um drei Stunden ausgeweitet werden, um eine flexiblere Verteilung der Arbeitszeit zu ermöglichen. Zudem sollen die Vorschriften zur täglichen Ruhezeit und zur Sonntagsarbeit gelockert werden, denen ein „Recht auf Abschaltung“ gegenüberstünde. Nur zwei Artikel sind besonders umstritten: Artikel 28g (Vereinbarung über Telearbeit) und Artikel 28h (Arbeitsinstrumente und Spesen). Diese enthalten privatrechtliche Regelungen, die nicht ins Arbeitsgesetz gehören.
In der Praxis werden diese neuen Bestimmungen, einmal in Kraft getreten, keine revolutionären Veränderungen für Unternehmen bringen. Vielmehr werden sie bestehende Arbeitsrealitäten gesetzlich anerkennen – und das weitgehend ohne Widerspruch. Der Grund dafür liegt auf der Hand: In den meisten Fällen sind es die Arbeitnehmer selbst, die Telearbeit wünschen und schätzen, weil sie ihnen eine bessere Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben ermöglicht, ohne sie an starre Zeitvorgaben zu binden. Nicht zu vergessen, dass die hier diskutierten Bestimmungen nur Arbeitnehmer ansprechen, die „über eine grosse Autonomie bei der Arbeit verfügen“ und „in den meisten Fällen ihre Arbeitszeiten selbst festlegen können“.
„In den meisten Fällen sind es die Angestellten, die Telearbeit wünschen, und sie schätzen es auch, sich von einem strengen Zeitkorsett befreien zu können.“
Das Arbeitsgesetz gründlicher überarbeiten
In seiner Vernehmlassungsantwort hat Centre Patronal auf seine eigenen Reformvorschläge zum Arbeitsgesetz (ArG) vom Juni 2024 hingewiesen. Das grundlegende Problem des ArG besteht darin, dass es ursprünglich für die Industrie konzipiert wurde und den heutigen Anforderungen des dominierenden Dienstleistungssektors nur unzureichend gerecht wird. Über die Jahre hat man versucht, diese Unzulänglichkeiten durch zahlreiche Ausnahmeregelungen zu kompensieren – mit dem paradoxen Ergebnis, dass das Gesetz inzwischen mehr Ausnahmen als allgemeine Grundsätze enthält.
Da eine vollständige Revision derzeit nicht absehbar ist, wäre es sinnvoll, die allgemeinen Bestimmungen zu Arbeits- und Ruhezeiten nicht nur im Bereich der Telearbeit, sondern insgesamt flexibler zu gestalten. Dies könnte durch den Verzicht auf übermässig detaillierte Vorschriften, die Umrechnung bestimmter Grenzwerte auf eine Jahresbasis sowie die Beibehaltung ausschliesslich jener Regelungen geschehen, die tatsächlich der Gesundheit der Arbeitnehmer dienen. Gleichzeitig sollte der Geltungsbereich des ArG klarer definiert werden: Arbeitnehmer mit überdurchschnittlichem Einkommen, hoher Autonomie und der Möglichkeit, ihre Arbeitszeiten selbst festzulegen – also genau jene, die heute bewusst versuchen, die starren Vorgaben des ArG zu umgehen – sollten ausdrücklich von der Gesetzgebung ausgenommen werden.
Weiterführende Informationen zum Beitrag “Lockerung der Vorschriften für Telearbeit“:
10.09.2024, Medienmitteilung WAK-N: Mehr Gestaltungsfreiheit bei Arbeit im Homeoffice: WAK-N eröffnet die Vernehmlassung